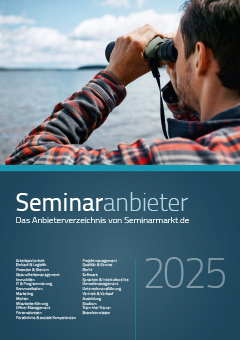ISA Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe
Lernformate der ISA SchulungenPräsenzunterricht // Onlinekurs bzw. Fernkurs // Kombination Präsenz & Online
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 14.532 Schulungen (mit 65.272 Terminen) zum Thema ISA mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
Arbeitsrecht im Einkauf + Logistik – Grundlagen Grundlagen der Zeitarbeit - Inhouse
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
a) Muss - Klauseln
b) Kann - Klauseln
c) Soll - Klauseln
d) Welche Klauseln sind unwirksam?
2. Zulässiger Inhalt und Umfang von Bewerbungsbögen + Tests
3. Der Abkehrwille und seine rechtliche Bedeutung/Konsequenz
4. Die Arbeitsgesetze - ein Überblick
a) Grundgesetz + BGB + HGB
b) Gewerbeordnung
c) Reichsversicherungsordnung
d) Lohnfortzahlungsgesetz
e) Lohnzahlung an Feiertagen
f) Bundesurlaubsgesetz
g) Gesetz über die Fristen für die Kündigung von Angestellten
h) Angestelltenversicherungsgesetz
i) Kündigungsschutzgesetz
j) Arbeitsplatzschutzgesetz
k) Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
l) (Konkurs)/Insolvenzordnung
m) Arbeitsförderungsgesetz
n) Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, Fachkräfte, Arbeitssicherheit
o) Arbeitszeitordnung
p) Mutterschutzgesetz + Reichsversicherungsordnung
r) Schwerbehindertengesetz
s) AÜG - Gesetz + Heimarbeitsgesetz
t) Berufsbildungsgesetz
u) Tarifvertragsgesetz + Mindestarbeitsbedingungen
v) Betriebsverfassungsgesetz + Mitbestimmungsgesetz
w) Arbeitsgerichtsgesetz
5. Die Kündigung
a) durch den Arbeitnehmer
b) durch den Arbeitgeber
c) betriebsbedingt
d) personenbedingt
e) verhaltensbedingt
f) ordentliche oder außerordentliche Kündigung
g) die Voraussetzungen der Kündigung
h) rechtliche Schritte nach der Kündigung
Grundlagen der Zeitarbeit
Gesetzliche Grundlagen
Abwicklungsrechtliche Fragen
AÜG
- Die wirtschaftliche Notwendigkeit mit Abwägung der Chancen und Risiken
des AÜG(Formen des AÜG, Kosteneinsparpotentiale, Marktformung,
Strategiealternativen)
-Die unterschiedlichen Vertragsarten und -typen beim Outsourcing von Arbeit
-Rechte und Pflichten der vom Outsourcing Betroffenen
-Die Verhandlungs-Checkliste auf Multiple-Choice Basis (Sicherheit gegen
das „Vergessen“)
Besonderheiten des AÜG
- Die Bedeutung der umfassenden Prüfung des Verleihers
- Pflichten des Verleihers
- Pflichten des Entleihers (Einkauf)
- Verfahren bei Verletzung von behördlichen, gesetzlichen und sonstigen
Vorschriften
Abgrenzungsnotwendigkeiten
- Direktionsrecht, Weisungsrecht Verleiher/Entleiher
- Rechte und Pflichten beider Vertragspartner
- Haftung von beiden Vertragspartnern
- Gewährleistung und Leistungsstörungen
- Haftpflichtversicherungen
Scheinselbstständigkeit und notwendige Abhilfen
Überblick über die neueste Rechtsprechung zum AÜG
Verträge mit Zeitarbeitskunden
Vertragsabschluss + Vertragsmuster
Die Vertragscheckliste – was muß ´drin sein ?
( eine Zusammenstellung von min. 36 Klauseln)
Kalkulation
SCC + SCP-Ordner und andere Dokumente
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- 713,82 €
> Welche Anforderungen sind heute zu erfüllen?
> Änderung von Führung und Motivation (Wertewandel)
> Eine Führungs - Konzeption erarbeiten
> Führungssituationen ausprobieren, erfahren, diskutieren (mit Videokamera)
> Das Personal – Know - how
> Führung u. a.: mit Zielen führen, Delegation von Verantwortung, Moderatorenrolle
> Einkaufen im Team mit funktionsübergreifender Struktur
> Erlernen der Kreativitätstechnik und praktische Anwendung
2. Organisation
> Die verschiedenen Möglichkeiten der Aufbauorganisation und deren individuelle
Anpassung und Gestaltung
> Die moderne Gestaltung der Ablauforganisation
> Schnittstellenprobleme und deren Beseitigung
> Innovationsmanagement und die organisatorischen Voraussetzungen
> Die lernende Organisation und weitere Elemente des Erfolgs
> Steigerung der Wettbewerbskraft durch schlanke Geschäftsprozesse
> Ganzheitliches Denken und Handeln, die Konsequenzen für die Organisation,
Methoden und Verfahren zur Veränderung
3. Rhetorik
> Rhetorische Grundregeln, die sich bewährt haben
> Ausbau der eigenen Sprache als Instrument
> Die Bedürfnisse der Angesprochenen erkennen und berücksichtigen
> Transaktionsanalyse (TA)
> Wirkungsvoll Feedback erhalten (z.B. Körpersprache u.v.m.)
> Inhalts- und Beziehungsebene berücksichtigen
> Fragearten
> Technik (z.B. Pausen als Waffe, nonverbale Elemente)
> Erfolgreiche Taktiken
> Einwandbehandlung
> Selbstsicherheit weiter vergrößern – aber wie?
> Mit Freude gekonnt überzeugen
> Praktische Übungen mit Videokamera
4. Gestaltung
> Erarbeitung einer Visoin – aber wie?
> Neugestaltung der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden
> Outsourcing von Teileistungen
> Benchmarking-Vorgehen, Vorteil-Nachteil, Nutzen und Risiken
> Service steigern, Kosten begrenzen – aber wie?
5. Verfahren
> Technische Verfahren wie Checklisten, Standardformulare, Standardbriefe
> Gemeinsame Entscheidungen (Wertanalyse und make or buy)
> Verschiedene Arten des Sourcing und Lieferantenbeurteilung
> Moderne Arbeitsmittel – betriebswirtschaftliche Kennzahlen
> Der erfolgreiche Projekteinkauf – Projektmanagement – aber wie?
> Praktische Maßnahmen – aber wie? (techn. Verfahren, Komplexitätsreduktion,
Prozesskostenrechnung, Gruppenarbeit etc.)
> Moderne Bürokommunikation, Dokumenten - Management
> Software – Lösung
6. Planung / Controlling
> Ergebnisplanung und –messung durch Einkaufscontrolling
> Die Auswahl der Einkaufskennzahlen und -einzelgrößen
> Wie wird der Vergleichsmaßstab gefunden und ermittelt?
> Wie können mit wenig laufendem Aufwand die Ergebnisse und
Nutzen berechnet werden?
> Wie lassen sich rechtzeitig Risiken erkennen und abwehren
> Planungsverfahren
Disposition + Arbeitsvorbereitung - Inhouse
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
Grundlagen der Arbeitsvorbereitung
Arbeitsplanung „Fertigungsplanung“ (PP)
Fabrikplanung
Fertigungsstücklisten
Arbeitspläne
Vorgabezeitenermittlung
Konzeption Fertigungsmittel
Programmierung der Fertigungsmittel
Kalkulation der Erzeugniskosten
Sonstige planerische Aufgaben
Arbeitssteuerung „Fertigungssteuerung“ (S)
Materialdisposition, Bedarfsplanung, Bestellrechnung etc.
Termin- und Kapazitätsplanung mit:
Durchlaufterminierung
Kapazitätsbelastung
Kapazitätsabgleich
Werkstattsteuerung mit
Rechtzeitigem Auftragsstart
„Papiere“ auch elektronisch
Arbeitsfortschrittskontrolle
Dispositionsverfahren und Planungsgrundlagen
Verbrauchsgesteuerte Materialdisposition(stochastisch) für B- und C-Teile
Andlersche Losgrößenformel
Bestellpunktverfahren
Bestellrhythmusverfahren
Stückperiodenausgleich
Kanban
arithmetischer Mittelwert
gleitender Mittelwert
gewichteter gleitender Mittelwert
lineare Regression
nicht lineare Regression
exponentielle Glättung 1. und 2. Ordnung
ABC-Analyse
deterministische Materialdisposition (plangesteuert) für A-Teile
Absatzplan
Wiederbeschaffungszeit
Lagerbestand
Stücklistenauflösung
Bruttobedarfsrechnung
Nettobedarfsrechnung
ABC-Analyse
Terminierung
Vermeidung von Überlastung
Vermeidung von nicht genutzten Kapazitäten
Kapazitätsausgleich
Verfügbare Kapazität
Fertigungsprozesskette
Kapazitätsgrenzen
Vorwärtsterminierung
Rückwärtsterminierung
Mittelpunktterminierung
Durchlaufterminierung
Strategien der Terminierung
Arbeitspläne, -zeiten und Belegung
Kapazitätsberechnung
> MRP II – Manufacturing Resources Planning
Personalmanagement Kompakt Stärke durch Kompetenz nicht durch Macht - Inhouse
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
a) gesetzliche Konzeption
b) seine Rechte
c) seine Pflichten
d) Handlungsmöglichkeiten
2. Organisation
a) Organigramm (Aufbauorganisation)
b) Ablauforganisation
c) Stellenbeschreibung
d) M b O - Management by Objectives
e) quantifizierte und qualifizierte Zielvorgabe
f) Stellenbeschreibung
g) Führungs- und Fachaufgaben
3. Der Arbeitsvertrag für Führungskräfte
4. Führung – Grundsätze
> Grundsätze und Leitlinien der Führung
> Tiefenpsychologische Grundlagen
> Anforderungen
> Vision entwickeln
> Defizitbeseitigung
> Führung der eigenen Person
> Rollenprobleme
> Aktiv zuhören/ Besprechungen gestalten
> Körpersprache
> Kommunikationsanalyse / Rhetorik / Fragen + Einwände
> Methoden
? Mind-Mapping anwenden
? Ziele formulieren (schriftlich)
? Gedächtnisschlüssel anwenden
? Motivationstypen erkennen
? Kreativitätsmethoden anwenden
?
5. Arbeitszufriedenheit, Mitarbeiterbeurteilung, -gespräch
> Vorbereitung des Gesprächs
> Was ist zu beachten ?
> Rahmenbedingungen gestalten
> Körpersprache – Wirkungen
> Aktiv zuhören/ Besprechungen gestalten
> Kommunikationsanalyse / Fragen + Einwände
> Rhetorische Empfehlungen
> Körpersprache
> Auswechseln und Motivation von Mitarbeitern
> Anerkennung und Kritik
> Probleme mit Mitarbeitern (Sucht und Schlechtleistung)
> Fragebogen auswerten
6. Das Einstellungsgespräch
1. Was weiß ich über meinen künftigen Mitarbeiter
> Welche Informationen könnten wichtig sein?
> Woher bekomme ich sie?
2. Welches Outfit ist angebracht?
3. Wie trete ich positiv auf?
> Treffe organisatorische Vorbereitungen.
> Höre aktiv zu.
4. Welche Fragen muss ich beim Gespräch stellen?
5. Welche Reaktionen sind nicht angebracht?
6. Was soll bzw. darf ich fragen?
> beruflicher Werdegang
> Schulbesuch, Ausbildung, Gründe für Studiengangwahl, -wechsel oder
-abbruch, Lieblingsfächer, Weiterbildung, berufliche Erfolge/Misserfolge;
berufliche Wünsche, Ziele und Vorstellungen
fachliche Stärken und Schwächen, Erwartungen an die neue Position, die neuen Vorgesetzten, Mitarbeiter und Kollegen, Karriereziele, Bedeutung bestimmter Begriffe (wie z. B. Arbeit und Zufriedenheit),
Vorstellungen von der Dauer der Anstellung; allgemeine Interessen und
Einstellungen, persönliche Stärken und Schwächen, langfristige
berufliche und private Ziele, außerberufliches Engagement,
Freizeitverhalten; Persönliches und Privates Fragen zu Partnerschaft,
Kindern, Spannungsfeld Familie/Beruf etc.
?
7.Konfliktmanagement
> Typologie von Konflikten
? nach Streitgegenständen
? nach Erscheinungsformen
? nach Eigenschaften der Konfliktparteien
> Modelle der Konfliktdiagnose
> Dynamik der Eskalation
> Phasenmodell der Eskalation
> Interventionen der Konfliktbehandlung
> Die fünf Diagnosedimensionen als Ansatzpunkt für Interventionen
> Allgemeine Prinzipien für Interventionen
> Strategiemodelle der Konfliktbehandlung
> Verschiedene Strategiemodelle im Detail aus der Praxis
8. Motivation und Selbststeuerung
> Was ist Motivation?
> Die Grundlagen der Motivationsforschung
> Motivation – nur ein Aberglaube?
> Die verschiedenen Formen der Motivation
> Praktisches Ausprobieren von Motivation und Selbststimulans
> Die Verbesserung der Selbststeuerung
> Probleme der Selbststeuerung
> Praktische Empfehlungen
Alle Übungen mit Videokamera
Die erfolgreiche Einkaufsverhandlung. Erfolgreich gestalten und zielorientiert führen - Inhouse
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- 713,94 €
Ausgangsbasis und Voraussetzung
> Vor- und Nachteile für Einkäufer und Verkäufer
> Beschaffungsmarketing
> Persönliche Voraussetzung der Einkäufer und Verkäufer
> Kommunikationsanalyse
> Motivationstypen
> Körpersprache
> Kreativitätstechniken
> Verhandlungsverhalten, Dramaturgie und Phasen der Verhandlung
> Fragetechniken und -arten
> Redetypen und Einwände
> Korruption
> Die Verhandlungsarten
2. Vorbereitung der Verhandlung
> Rahmenbedingungen
> Vorbereitung des Gegenstandes der Verhandlung
> Zieldefinition
> Strategie
> Methodenwahl
> Checkliste zur Informationsmitteilung
3. Die Einkaufsverhandlung
> Der geplante Ablauf
> Ergebnisprotokoll
> Soll / Ist – Vergleich nach der Verhandlung
4. Verhandlungsübungen mit Videokamera
> Körpersprache, verschiedene Situationen per Videoaufzeichnung
> das interne Vorbereitungsgespräch
> das Preisabwehrgespräch
> das Kaufgespräch
> die Reklamation
> die Lieferterminuntreue
> Formulierungsalternativen – wie sage ich es dem Lieferanten
> Strategien und die Umsetzung
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
1.1 Anwendung der Personalwirtschaft im Modul HR
1.2 Einführung in SAP R/3 4.6.
1.3 Systemstart und Anmeldung.
1.4 Zugangsoptionen.
1.5 Basis.
1.6 Das SAP Menü
1.7 Grundfunktionen im Personalbereich
1.8 Bereiche des Personalmanagements
1.9 Module der Personalentwicklung
1.10 Integration – Schnittstellen
1.11 Integrationsbeispiele
2 SAP Personalmanagement (PA)
2.1 Personalmanagement
2.2 Personaladministration
2.3 Prozesse der Personaladministration.
2.4 Stammdatenpflege
2.5 Das Arbeiten mit Personalstammdaten.
2.6 Personalstammdaten pflegen.
2.7 Besetzung von Planstellen
2.8 Personalmaßnahme: Einstellung.
2.9 Berichte
3 SAP Personalabrechnung (PY/PAY)
3.1 Abrechnungsrelevante Daten.
3.2 Ablauf der Personalabrechnung.
3.3 Folgeaktivitäten und Auswertungen.
3.4 Grunddaten der Personalabrechnung.
3.5 Grundstrukturen.
3.6 Abrechnungsrelevante Personaldaten.
3.7 Vergütungsrelevante Stammdaten.
3.8 Vergütungsrelevante Zusatzdaten.
3.9 Vergütungsrelevante Zeitdaten.
3.10 Ablauf der Personalabrechnung.
3.11 Steuerung der Abrechnung.
3.12 Bearbeitung der Abrechnung.
4 SAP Veranstaltungsmanagement und Personalentwicklung (PE)
4.1 SAP-Veranstaltungsmanagement.
4.2 Module der Personalentwicklung.
4.3 Integration - Schnittstellen.
4.4 Integrationsbsp..
Umfang der Funktionen im Modul HR
4.5 Profil
4.6 Laufbahn- und Nachfolgeplanung
4.7 Individuelle Entwicklung
4.8 Beurteilung
4.9 Einige Grundfunktionen
MaskeProfilanzeigenundQualifikationen
MaskePotentiale
MaskeInteresse
MaskePersonalstammdaten
Praxisbeispiele
4.10 Beispiel Laufbahnplanung
Modul Laufbahnplanung
Prüfung der Stelleneignung
Profilvergleich
Kursanmeldung für empfohlene Kurse
Beispiel Nachfolgeplanung
Maske Nachfolgeplanung
prüfung der Qualifikation einzelner Personen
Benutzerdefinierte Suche
4.11 Ziele der Personalentwicklung
4.12 Vorteile der Personalentwicklung in SAP
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
2. Der steigende Einfluss des Einkaufs auf die Unternehmensführung
- Innovationsmotor Einkauf
3. Neue Informationstechnologien - Internet / Intranet
> Purchasing Cards
> Electronic Commerce
> Automatic office
> Geschäftspost outsourcen
> Eigene Einkaufspage
> Einkäufer – Laptop vernetzt
> Palmtops / Kombi – Handy u. v. m.
4. Einkaufsverfahren: > Routinen automatisieren (Beispiel aus der Praxis)
/-prozesse > Abwicklung reduzieren durch verschiedene
Ressourcen
> neue Verfahren und Arbeitsweisen
(werden detailliert vorgestellt)
> selbststeuernde Systeme
> Verfahren zur Steigerung der Einkaufswertschöpfung
> virtuelle Einkaufswelt
5. Effizientes Lieferantenmanagement
6. Neue Einkaufsgewinnquellen
7. Global Sourcing
8. Outsourcing
9. Green procurement und der Einfluss auf TCO-Entscheidungen
10. Die Top 10 der Einkaufswertschöpfung
> Vorgehen und Empfehlung
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
2) Prozesskostenrechnung - Anwendung
3) Was kosten die Versandprozesse in meinem Unternehmen heute?
4) Welche Versandprozesse lassen sich sinnvoll outsourcen
5) Was kosten diese außerhalb?
6) Welche Alternativen gibt es?
7) Analyse der Ausgangssituation
8) räumliche Aufnahme
9) Aufnahme der Prozesse in der Lagerwirtschaft
10) Aufnahme der Lagergüter und Lagermittel
11) Aufnahme der Kostensituation
12) Aufnahme der personellen Ausstattung
13) Analyse des Verbesserungspotentials mittels Checklisten und am PC
14) Erarbeitung eines alternativen Lagerkonzeptes mit Empfehlungen für
die Lagerumstellung und Nutzung des Verbesserungspotentials
Stress erfolgreich bewältigen - Inhouse
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
- positive Ausprägung
- negative Ausprägung
2) Die Ursachen und Auslöser des Stresses
2.1 äußere Ursachen
> Lärm, Kälte, Überangebot an Reizen, Mobbing
2.2 innere Ursachen
> Angst vor Ablehnung, geringes Selbstwertgefühl, mangelnde
Delegationsfähigkeit, schlechte Zeiteinteilung, perfektionistische
Anforderungen, geringes Durchsetzungsvermögen, Angst vor
Verantwortung, schlechte Körperhaltung, falsche Ernährung
Suchtmittelabhängigkeit, Angst vor Kontrollverlust, Denkgewohnheiten
2.3 Stressthermometer
3) Verschiedene Formen der Wahrnehmung
- Your perception is your reality –
4) Welcher Stresstyp bin ich?
5) Verschieden Stressbewältigungstechniken
- Nutzung von NLP
- sonstige Programmiertechniken
6) Wege zur Verwandlung des negativen Stresses in positiven Stress
7) Änderung der Wahrnehmung
8) Positive Programmierung
9) Für jeden Teilnehmer ein individuelles und praktisches Arbeitsprogramm
- Termin auf Anfrage
- Ort auf Anfrage
- auf Anfrage
der Preisarbeit im Internet
2. Adressensammlung für neue Verfahren der Preisarbeit
3. Neue effitiente Methode des Suchens und Findens von Fakten für die neue
Preisarbeit
4. Auswertungsverfahren der vielen neuen Informationen der neuen Preisarbeit
5. Grenzen der neuen Preisarbeit
6. Praktische Empfehlungen und Konzepterstellung für die Praxis